Sherlock Holmes ist eine bemerkenswerte Person. Kein Fall ist zu schwierig, um gelöst zu werden, kein Gedanke dabei zu abwegig, um in Betracht gezogen zu werden. Mit seiner bewundernswerten Spitzfindigkeit und Hartnäckigkeit löst Sherlock Holmes selbst Fälle, die von anderen als unlösbar klassifiziert wurden.
In der Psychologie verhält es sich ähnlich: Um die Gründe und Mysterien menschlichen Verhaltens zu erklären, ist eine lange und umfangreiche Detektivarbeit nötig. Glücklicherweise gibt es Menschen, die diesen Bereich systematisch wissenschaftlich untersuchen und für unseren Alltag beeindruckende Erkenntnisse liefern. Ob Sie nun im Management, der Gastronomie, in der Justiz oder in der Politik arbeiten – unsere folgenden sieben Psychologie-Tricks werden Ihnen im Geschäftsalltag große Dienste leisten.
Haben Sie auch schon mal eine ähnliche Situation erlebt? Man fährt zum Einkaufen in den Supermarkt und hat den Liebsten Zuhause versprochen Schokolade mitzubringen. Doch kaum vor dem Regal angekommen, erdrückt einen die riesige Auswahl. Vollmilch-, Zartbitter-, Halbbitter-, Nuss-, Rosinen- oder weiße Schokolade: Welche der vielen Schokoladen soll man kaufen?
Dieses Beispiel ist typisch für unsere heutige Welt: Egal um welches Produkt oder welche Dienstleistung es heutzutage geht – von (fast) allem gibt es gefühlt eine riesige Auswahl in allen möglichen Variationen und Facetten. Die Verhaltensforscherin Sheena Iyengar und der Sozialwissenschaftler Mark Lepper untersuchten deswegen, ob zu viele Auswahlmöglichkeiten sich negativ auf die Kaufentscheidung auswirken. Dafür ließen sie in einem Supermarkt zwei Stände mit verschiedenen Marmeladesorten eines Herstellers aufstellen, wobei die Anzahl der dabei angebotenen Sorten einmal sechs und ein anderes Mal 24 Geschmacksrichtungen umfasste. Der daraus resultierende Effekt war beeindruckend: Nur drei Prozent aller Personen, die auf den Marmeladenstand mit 24 Geschmacksrichtungen zugingen, kauften überhaupt ein Glas. Wurden dagegen nur sechs Marmeladesorten am Stand angeboten, waren es 30 Prozent aller Personen, die ein Glas kauften.
Die spannende Frage, die sich hierbei ergibt, ist, ob diese Erkenntnis aus dem Supermarkt sich auch auf andere Bereiche des Lebens übertragen lässt, z. B. auf Bereiche, die eine deutlich größere Tragweite und Konsequenzen haben. Tatsächlich ja! Denn Sheena Iyengar und ihr Team untersuchten vor der Supermarktstudie die gleiche Problematik beim Thema Altersabsicherung. Dafür analysierten sie geförderte Pensionspläne für fast 800.000 Arbeitnehmer von US-Firmen und verglichen deren Teilnahmequoten mit der Anzahl der angebotenen Optionen. Dabei stellten sie fest, dass je mehr Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung standen, umso weniger Menschen sich für die entsprechenden Programme entschieden. Die Teilnahmequote sank im Durchschnitt pro zehn zusätzliche Angebote (Fonds) um fast 2 Prozent. Wurden z. B. zwei Fonds angeboten, lag die Teilnahmequote bei knapp 75 Prozent. Waren jedoch 59 Fonds im Angebot, sank die Quote dagegen auf etwa 60 Prozent.
Die Untersuchungsergebnisse zeigen damit eindrucksvoll auf, dass Entscheidungsprozesse bei zu vielen Auswahlmöglichkeiten als belastend empfunden werden. Zu viele Optionen gegeneinander abzuwägen, bedeutet also tatsächlich, die Qual der Wahl zu haben. Da jedoch niemand gern leidet, werden entsprechende Situationen gemieden, was sich im vorliegenden Fall negativ auf die Kaufbereitschaft auswirkt.
Für die Praxis kann es somit lohnenswert sein, sich an die alte Binsenweisheit zu erinnern, dass manchmal „weniger mehr ist“. Denn eine Verringerung der Auswahlmöglichkeiten kann das Interesse und die Kaufbereitschaft an Ihren Produkten oder Dienstleistungen steigern – insbesondere bei Kunden, die sich nicht sicher sind, was genau sie kaufen wollen.
Ein gutes Beispiel ist hierfür der US-Konzern Procter & Gamble mit seinem beliebten Shampoo „Head & Shoulders“. Als man dessen Sorten von 26 auf „nur noch“ 15 reduzierte, stiegen daraufhin die Verkaufszahlen um 10 Prozent. Es kann sich deswegen lohnen, die bestehende Produkt- und Dienstleistungspalette kritisch zu hinterfragen und sich dabei folgende Fragen zu stellen: Haben wir Kunden, die sich über ihre Bedürfnisse eventuell nicht im Klaren sind? Verwirrt sie womöglich eine allzu große Auswahl? Könnte dies dazu führen, dass sie deswegen woanders kaufen, als bei uns?

Im vorherigen Kapitel konnten wir uns davon überzeugen, dass die alte Binsenweisheit – weniger ist mehr – nicht an den Haaren herbeigezogen ist. Jedoch bedeutet dies im Umkehrschluss nicht, dass man auf mehrere Auswahlmöglichkeiten verzichten sollte. Es wird immer Situationen geben, bei denen eine zusätzliche Option nicht nur das Angebot attraktiver gestaltet, sondern auch besonders gern gewählt wird. Erstaunlicherweise zeigen hierbei zahlreiche Forschungsarbeiten, dass eine zusätzliche Auswahloption keinen Inhalt benötigt, um bei Menschen Wirkung zu zeigen. Diese kann schlicht auch aus „gar nichts tun“ bestehen.
Rom Schrift von der Wharton Business School und Jeffrey Parker von der Georgia State University gingen in einem Experiment der Frage nach, wie man Menschen von einer Wahl überzeugen und gleichzeitig dafür sorgen kann, dass diese bei ihrer Wahl auch bleiben. Die Teilnehmer des Experiments wurden gebeten, in einem Wörterpuzzle so viele Wörter wie möglich herauszufinden. Für jedes korrekt benannte Wort würden sie bezahlt werden, sie könnten jedoch die Aufgabe auch jederzeit abbrechen. Die Teilnehmer wurden hierfür in drei Gruppen aufgeteilt. In der ersten Gruppe mussten die Teilnehmer zwischen zwei Puzzles wählen. Sie hatten die Auswahl zwischen einem Puzzle mit Namen berühmter Schauspieler und einem anderen Puzzle, welches die Namen internationaler Hauptstädte als Thema hatte. In der zweiten Gruppe erhielten die Teilnehmer eine weitere Auswahlmöglichkeit, mit den Namen berühmter Balletttänzer. Die Mitglieder der dritten Gruppe sollten wiederum ähnlich wie die der ersten Gruppe, zwischen Schauspielern und Hauptstädten wählen, bekamen darüber hinaus aber auch die Option, sich für keines der Puzzles zu entscheiden – also „gar nichts zu tun“.
Die Ergebnisse waren bemerkenswert: Während es zwischen den ersten beiden Gruppen kaum Unterschiede gab, investierten die Teilnehmer der dritten Gruppe über 40 Prozent mehr Zeit in die Lösung, der von ihnen gewählten Aufgaben. Das einfache Hinzufügen der Auswahloption „nichts zu tun“ erhöhte somit die Wahrscheinlichkeit, dass die Teilnehmer (a) sich für etwas entschieden und (b) dabei auch deutlich mehr Zeit investierten.
Auf den ersten Blick erscheint dies keinen Sinn zu ergeben: Warum sollte die Option, etwas nicht zu machen, dazu führen, dass sich Menschen verstärkt für etwas entscheiden und dann auch bei ihrer Wahl bleiben?
Hier muss man den Zusammenhang beachten: Die Option, etwas „nicht zu tun“ ist nicht nur eine zusätzliche Wahlmöglichkeit, sondern schafft bei den Betroffenen vielmehr eine Verbindlichkeit bei ihrer Wahl. Die betreffende Person wird in ihrem Gefühl bestärkt, die richtige Wahl getroffen zu haben, sonst hätte sie ja auch den Ausstieg („nichts tun“) wählen können.
Für die Geschäftswelt stellt sich die Frage, ob die Option „nichts zu tun“ nicht zu riskant ist? Schließlich könnten im richtigen Leben, fernab von wissenschaftlichen Experimenten, Kunden von dieser Option Gebrauch machen. Hierbei lohnt es sich, sich nochmals das um über 40 Prozent gesteigerte Engagement der Teilnehmer vor Augen zu führen, die den eventuellen Verlust einzelner Kunden mehr als wettmachen. So könnte z. B. ein Ernährungsberater seine Kunden während der Beratung darauf hinweisen, dass diese sich jederzeit auch dafür entscheiden können, gar nicht weiter auf ihre Ernährung zu achten, um dadurch ein besseres Einhalten des von ihm erstellen Diätplans zu erreichen. Ein Handwerker könnte wiederum bei einem Kostenvoranschlag die Option beifügen, „gar nichts zu tun“, um dadurch mehr Aufträge abzuschließen. Es kann sich also lohnen, zu überlegen, ob diese Option auch in der eigenen Strategie Anwendung finden kann – aber natürlich können Sie sich auch entscheiden, hierbei „nichts zu tun“.

Postalische Kommunikation kann einem manchmal den letzten Nerv rauben. Da verschickt man Angebote und Verträge – und nur ein Teil kommt als Antwort (pünktlich) wieder zurück. Wäre es nicht wundervoll, wenn man Zeit, Geld und Nerven sparen könnte, indem man die Antwortquote durch einen einfachen Trick deutlich steigern könnte?
Der Sozialforscher Randy Garner ging dieser Frage nach, genauer gesagt, ob Haftnotizen dazu beitragen können, dass eine schriftlich vorgetragene Bitte häufiger befolgt wird. Im Rahmen seiner Studie verschickte er Fragebögen und bat darum, diese ausgefüllt wieder zurückzusenden. Begleitet wurden die Fragebögen entweder von (a) einer auf das Anschreiben geklebten Haftnotiz mit der handschriftlichen Bitte um Ausfüllung und Rücksendung, (b) einer gleichlautenden, handschriftlichen Bitte auf dem Anschreiben oder (c) dem Anschreiben ohne zusätzliche Bitte.
Die kleinen gelben Zettel hatten dabei eine schier magische Wirkung: Mehr als 75 Prozent der Menschen füllten den Fragebogen aus und schickten diesen wieder zurück. In der zweiten Gruppe waren es dagegen 48 Prozent und in der dritten Gruppe nur 36 Prozent. Darüber hinaus schickten die Empfänger der ersten Gruppe, die die Bitte als handschriftliche Haftnotiz erhalten haben, die Bögen auch schneller als alle anderen Gruppen zurück und gaben dazu detailliertere und aussagekräftigere Antworten. Weitere Untersuchungen von Randy Garner zeigen, dass es für den Erfolg auf die Kombination von Haftnotiz sowie handschriftlicher und persönlicher Botschaft ankommt (inkl. einem Danke!). Der Sozialforscher vermutet, dass diese Kombination den Empfängern zeigt, dass sich jemand persönlich Mühe gegeben hat und es ihm wichtig ist, weshalb sie das Bedürfnis verspüren, sich dafür zu revanchieren, indem sie der Bitte nachkommen.
Wenn Sie demnächst also ein Schreiben per Post verschicken, denken Sie an eine Haftnotiz. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine höhere Antwortquote mit qualitativ höherwertigen Inhalten erhalten, ist aus empirischer Sicht sehr hoch.

Wenn man seine Kompetenzen und Leistungen zeigen möchte, steht man oft vor einem Dilemma: Einerseits möchte man andere von der eigenen Leistung überzeugen, andererseits kann dies schnell auf andere prahlerisch und eingebildet wirken. Was tun?
Eine geläufige Praxis besteht darin, andere Personen für sich sprechen zu lassen. Ein Lob bzw. eine Empfehlung einer dritten Person bewirkt oft Wunder, wenn es darum geht, andere von den eigenen Kompetenzen und Leistungen zu überzeugen. Idealerweise handelt es sich dabei um Menschen, die diesen Part freiwillig und authentisch übernehmen. Doch nicht immer sind solche Mitstreiter motiviert und verfügbar, z. B. weil zufriedene Kunden keine Zeit dafür haben. Hier bietet es sich an, Personen dafür zu bezahlen und sich dem in der Sozialpsychologie bekannten „fundamentalen Attributionsfehler“ zu eigen zu machen. Es geht dabei um einen der häufigsten Fehler, den Menschen begehen: Wenn wir das Verhalten einer anderen Person beobachten, neigen wir dazu, die dafür in Frage kommenden situativen Faktoren zu vernachlässigen bzw. auszublenden, z. B. dass eine Person dafür bezahlt wird. Dies trifft auch auf offensichtliche Fälle zu, wie z. B. bei Prominenten in der Werbung. Erstaunlich viele Menschen sind davon überzeugt, dass Prominente, die in der Werbung entsprechende Produkte anpreisen, diese tatsächlich nutzen und lieben – obwohl eigentlich jedem klar sein dürfte, dass diese dafür sehr viel Geld bekommen.
Sie müssen jetzt jedoch keine teuren Stars und Sternchen engagieren, die für Sie Lobeshymnen singen. Ein einfacher und effektiver Weg ist es die eigenen Mitarbeiter mit ins Boot zu holen. Das Forscherteam Noah J. Goldstein, Steve J. Martin und Robert B. Cialdini berichten hierbei von einem Immobilienmaklerbüro, dass diese Strategie sehr erfolgreich für sich nutzt. Ruft man dort an, fragt die Empfangsdame zunächst, welche Abteilung man wünsche (Vermietung oder Verkauf). Alle die sich für Vermietung interessieren, bekommen dann zu hören: „Ah, es geht um eine Vermietung. Dann müssen Sie mit Frau Müller sprechen. Sie hat über 15 Jahre Erfahrung mit der Vermietung von Häusern und Wohnungen in dieser Gegend. Einen Moment, ich stelle Sie gleich durch.“ Wer wiederum mit der Verkaufsabteilung sprechen möchte, dem wird gesagt: „Ich stelle Sie zu Herrn Meier durch, dem Leiter unserer Verkaufsabteilung. Er hat 20 Jahre Erfahrung mit dem Verkauf von Immobilien. Erst kürzlich hat er ganz in ihrer Nähe ein Haus verkauft.“ Die Dinge, die die Empfangsdame über ihre Kollegen erzählt, entsprechen der Wahrheit. Frau Müller hat tatsächlich 15 Jahre Berufserfahrung und Herr Meier gehört zu dem besten Immobilienmakler der Gegend. Würden die beiden dies ihren Kunden selbst erzählen, würde dies als peinliches Selbstlob ausgelegt und wenig vertrauenserweckend wirken. Dadurch, dass die Empfangsdame diese Rolle übernimmt, profitieren die beiden von der positiven Darstellung. Sowohl Frau Müller als auch Herr Meier berichten von einem deutlichen Anstieg der Kundentermine, seitdem die Ansagen umgestellt worden sind. Interessant dabei ist, dass die Empfangsdame mit den beiden verbunden ist und von ihrer Firma dafür bezahlt wird, die Kunden diesen Umstand aber gekonnt ignorieren.
Falls dies bei Ihnen in gleicher oder ähnlicher Form nicht umsetzbar ist, so können Sie auf einen subtileren, aber dafür nicht weniger effektiven Weg ausweichen: Hängen Sie einfach Ihre Zeugnisse, Zertifikate, Diplome oder Auszeichnungen prominent in Ihrem Büro bzw. Eingangsbereich aus oder platzieren Sie diese auf Ihrer Homepage. Hauptsache, niemand kann sie übersehen. Die entsprechende Wirkung steht einer persönlichen Empfehlung in nichts nach.

Rabatt- und Kundenkarten lassen sich in unzähligen Portemonnaies finden. Im Land der Schnäppchenjäger eine Win-Win-Situation für Kunden, die (vermeintlich) sparen wollen und für Unternehmen, die ihre Kunden an sich binden wollen. Die Konsumforscher Joseph Nunes und Xavier Dreze zeigten mit einer Studie, wie man Kundentreue noch wirksamer fördern kann. Im Rahmen ihrer Untersuchung händigten sie an 300 Kunden einer Autowaschanlage Treuekarten für eine Gratiswäsche aus, bei der es für jede Autowäsche einen Stempel auf die Karte gab. Eine Hälfte der Kunden erhielt eine leere Treuekarte mit acht Feldern. Die andere Hälfte erhielt eine Karte mit zehn Feldern, bei der jedoch schon zwei Felder abgestempelt waren. Rein mathematisch waren also beide Kartenvariationen äquivalent, denn bei beiden benötigten die Kunden acht Autowäschen, um in den Genuss einer Gratiswäsche zu kommen.
Mehrere Monate später zeigte sich jedoch, dass die Karte mit zehn Feldern, bei der zwei Felder bereits abgestempelt waren, deutlich effektiver war. Während bei der Karte mit acht Feldern nur 19 Prozent der Kunden oft genug gekommen waren, um eine Gratiswäsche als Bonus zu erhalten, waren es bei der Karte mit zehn Feldern 34 Prozent der Kunden gewesen. Ebenfalls benötigten Kunden der Zehnerkarte im Durchschnitt 2,9 Tage weniger, um das Ziel einer vollen Treuekarte zu erreichen.
Die Konsumforscher erklären den durchschlagenden Erfolg der zweiten Gruppe damit, dass die bereits zwei abgestempelten Felder den Kunden das Gefühl gaben, im Treueprogramm bereits fortgeschritten zu sein und dieses nur noch vervollständigen zu müssen. Hierbei zeigen auch andere Studien, dass Menschen motivierter sind ein Ziel zu erreichen, wenn sie das Gefühl haben, diesem ein Stück näher gekommen zu sein.
Falls bei Ihnen im Unternehmen keine Möglichkeit von Treue- oder Bonuskarten besteht, können Sie diese Erkenntnisse dennoch nutzen. Wenn Sie erreichen möchten, dass Ihr Kunde (oder ein Kollege) an einem Projekt motivierter und engagierter mitarbeitet, ist alles, was Sie dafür tun müssen, Ihrem Gegenüber mitzuteilen, dass die entsprechende Arbeit bereits fortgeschritten ist. So können Sie sagen, dass Sachverhalt XY bereits zu 35 Prozent erledigt ist. Mit dieser Information wird die Motivation Ihres Kunden oder Ihres Kollegen, sich dem anzuschließen, deutlich höher ausfallen.

Sei es ein Kugelschreiber, USB-Sticks oder Gutscheine – ein Blick auf den Schreibtisch genügt oft, um festzustellen, dass Gratisgeschenke sich sowohl bei Verkäufern als auch bei Kunden großer Beliebtheit erfreuen. Doch Gratisgeschenke können auch das Gegenteil von dem bewirken, wofür sie gedacht sind.
Die Sozialwissenschaftlerin Priya Raghubir untersuchte, ob ein Gratisgeschenk, dass beim Kauf eines Produkts mitangeboten wird, in der Vorstellung der Verbraucher stark an Wert verliert. Priya Raghubir ging dabei der These nach, dass Verbraucher Gratisprodukte als minderwertig oder als Ladenhüter ansehen, da „schließlich niemand etwas Wertvolles zu verschenken hat“. Um dies zu überprüfen musste eine Gruppe von Teilnehmern in einem Duty-free Katalog den Wert eines Perlenarmbands bewerten, das als Gratisgeschenk zu einem Weinbrand angeboten wurde. Die andere Gruppe musste den Wert des Armbands als eigenständiges Produkt schätzen. Das Ergebnis: Der Wert des Perlenarmbands als Gratisgeschenk wurde um 35 Prozent geringer eingeschätzt als der Wert des gleichen Armbands als eigenständiges Produkt.
Für Unternehmen, die etwas dadurch bewerben, dass sie ein anderes kostenpflichtiges Produkt oder eine Dienstleistung aus ihrem Sortiment als kostenlose Beigabe mit dazu anbieten, sind dies schlechte Nachrichten. Denn in den Augen der Kunden bedeutet „kostenlos“ oder „gratis“ in Zahlen eine Summe von 0,00 Euro – also das Gegenteil von dem, was man erreichen möchte.
Umgehen kann man diese Problematik, indem man direkt darauf hinweist, dass das kostenlos beigelegte Produkt normalerweise bezahlt werden müsste und dabei den Wert des Gratisgeschenks benennt. Ein Autohändler, der mit „kostenlosen Winterreifen“ zum Autokauf wirbt, wäre somit besser beraten, wenn dieser „mit Winterreifen im Wert von 300 € gratis zum Autokauf“ wirbt.

Kinder haben ein magisches Talent dafür, Fragen zu stellen, auf die viele Erwachsene spontan keine passende Antwort besitzen: „Warum dürfen wir am Tisch nicht mit Fingern essen?“ „Wieso tragen Mädchen Kleider und Jungs nicht?“ Viele antworten dann intuitiv mit: „Weil das halt so ist!“ Bemerkenswerterweise geben sich viele Kinder mit dieser Antwort zufrieden. Doch auch bei Erwachsenen bewirkt das Zauberwort „Weil“ wahre Wunder. Die Verhaltenswissenschaftlerin Ellen Langer hat dieses Phänomen mit ihrem „Fotokopierer-Experiment“ eindrucksvoll zur Schau gestellt. Im Rahmen der Studie ging eine Fremde auf eine Schlange von wartenden Personen vor einem Fotokopierer zu und bat diese, sie vorzulassen. In der ersten Variante fragte sie: „Entschuldigen Sie, ich habe fünf Seiten zu kopieren. Könnten Sie mich bitte vorlassen?“ In diesem Fall waren 60 Prozent der Wartenden bereit, sie vorzulassen. In einer anderen Variante fragte die Fremde dagegen: „Könnten Sie mich bitte vorlassen, weil ich es eilige habe?“ Hier ließen 94 Prozent der Wartenden die Fremde vor.
Nun mag dies auf den ersten Blick nicht überraschend sein, denn Zeitnot ist ein nachvollziehbarer und guter Grund für solch eine Bitte. Doch an diesem Punkt der Studie wird es erst richtig interessant, denn Ellen Langer und ihr Team verwendeten noch eine weitere Version, die mit 93 Prozent Zustimmungsrate ebenfalls einen durchschlagenden Erfolg hatte. Was genau hat die Fremde gesagt?
Sie fragte: „Könnten Sie mich bitte vorlassen, weil ich kopieren muss?“.
Ja, Sie haben richtig gelesen: 93 Prozent der Wartenden haben die Fremde vorgelassen, obwohl sie keinen plausiblen Grund für den Vortritt nannte. Dies kann durch konditionierte Assoziationen erklärt werden, die einen Automatismus bei uns hervorrufen. Wir sind es gewohnt, dass nach einem „Weil“ eine gute Begründung folgt, wodurch wir häufig bei kleineren Dingen diese nicht mehr aktiv hinterfragen. Anders sieht es jedoch aus, wenn es um bedeutsamere Angelegenheiten geht. Auch hier liefert das Experiment interessante Ergebnisse. Wenn die Fremde in einer anderen Variation sagte, dass sie 20 Kopien machen möchte und dies nicht mit einem „Weil“ begründete, reagierten nur 24 Prozent der Wartenden positiv auf ihre Bitte. Jedoch zeigte sich, dass auch eine Begründung („Weil ich kopieren muss“) keine Steigerung zur Folge hatte. Nur der legitime Grund „Weil“ ich es eilig habe konnte die Zustimmung verdoppeln. Diese niedrigeren Zustimmungswerte sind auch nicht verwunderlich, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass die Wartezeit mit jeder zusätzlichen Kopie ansteigt. In diesem Fall war die Anzahl von 20 Kopien mit der daraus resultierenden längeren Wartezeit zu bedeutsam, als dass der Automatismus des Wortes „Weil“ seine komplette Wirkung hätte entfalten können.
Die Fotokopierstunde von Ellen Langer und ihrem Team zeigt uns damit, dass es sinnvoll ist, unsere Anliegen stets mit einer stichhaltigen Begründung vorzutragen – auch wenn wir der Meinung sind, dass die Gründe für andere offensichtlich sind.

Lust auf noch mehr Psychologie-Hacks?
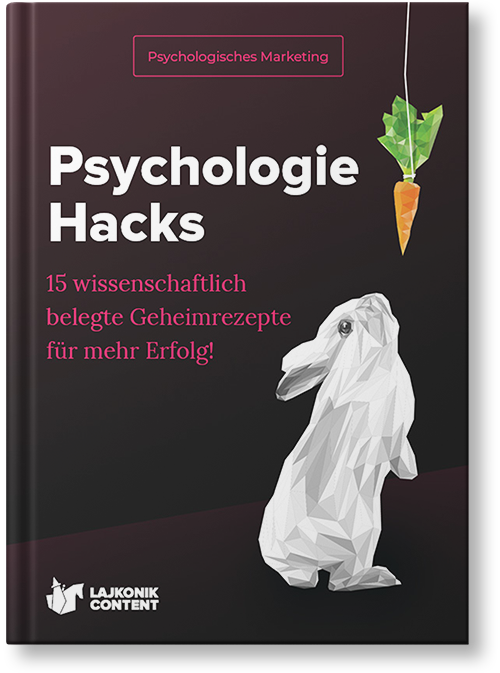
Sie möchten uns unverbindlich kennenlernen oder haben Fragen, wie Sie mit psychologischer Expertise mehr Kunden und damit mehr Umsatz erzielen können? Wir sind nur eine E-Mail oder ein Telefonat entfernt!
PS: Hier geht es zu unserem psychologischem Marketing.
Wollen Sie wirklich nichts unternehmen?
Mit unserer Unterstützung konnten wir bereits zahlreichen glücklichen Kunden zu mehr Umsatz und höheren Gewinnen verhelfen.
Lassen Sie sich unverbindlich und kostenlos beraten, wie auch Sie in den Genuss höherer Umsätze und Gewinne kommen. Wir sind nur ein Telefonat oder eine E-Mail entfernt.
Vielen Dank!
Ihre Nachricht wurde erfolgreich gesendet.
Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.
Kursinhalt