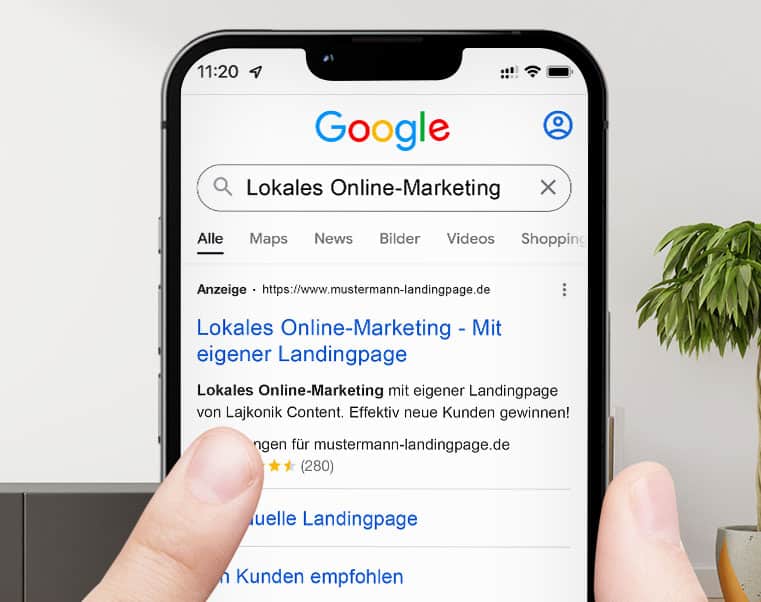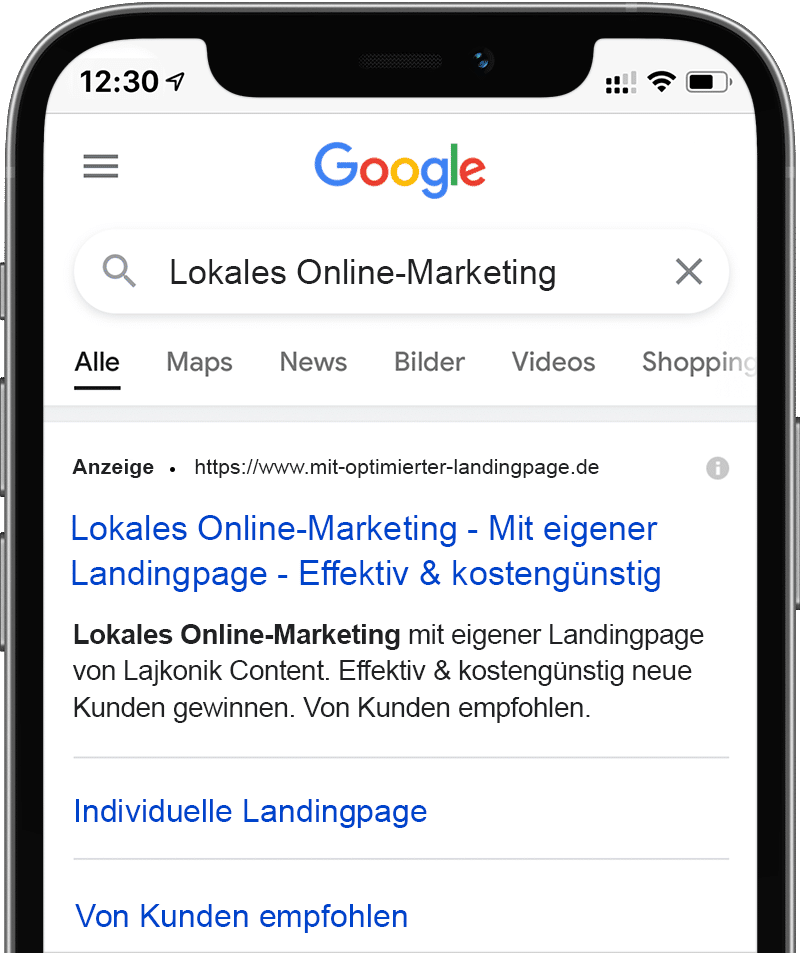Der Alltag ist voller kleiner und großer Situationen, bei denen wir schnell ein Urteil oder eine Entscheidung treffen müssen. Stellen Sie sich hierzu vor, Sie würden mit folgender Frage konfrontiert werden: „Wird Herr Müller eine gute Führungskraft sein? Er ist intelligent und stark …“. Wahrscheinlich lautet Ihre spontane Antwort „Ja“. Doch was wäre, wenn der Satz mit den Adjektiven „korrupt“ und „skrupellos“ weitergehen würde?
Wie wir bereits wissen, arbeitet das schnelle und intuitive System 1 mit Assoziationen. Da jedoch einzelne Assoziationen für Meinungen, Urteile und Entscheidungen nicht ausreichen, erstellt System 1 aus den uns vorliegenden Informationen automatisch eine möglichst „sinnvolle“ Geschichte. Für System 1 ist es hierbei jedoch wichtiger, dass die dabei konstruierte Geschichte plausibel und widerspruchsfrei erscheint, als dass diese auf Fakten und Logik beruht. Dies geht sogar so weit, dass für das Ziel einer möglichst plausiblen Geschichte die Qualität und Quantität der dabei verwendeten Informationen vollkommen unbeachtet bleibt. Selbst wenn die geringe Belastbarkeit einer (fragwürdigen) Quelle bekannt ist, wird diese zu Gunsten einer möglichst plausibel erscheinenden Geschichte genutzt.
Erschwerend kommt hinzu, dass das System 2 als relativ faule Kontrollinstanz dazu neigt, die von System 1 erstellen Geschichten unkritisch zu übernehmen, je plausibler diese klingen. Und genau hier zeigt sich die Wurzel des WYSIATI-Effekts: Denn für System 1 gestaltet es sich einfacher, eine plausible Geschichte mit wenigen Informationen zu konstruieren als mit vielen Informationen. Denn je mehr Informationen vorliegen, desto schwieriger wird es, eine widerspruchsfreie und plausible Geschichte zu erstellen, ohne dass das System 2 am Ende doch noch korrigierend eingreift.
Aus evolutionsbiologischer Sicht ist der WYSIATI-Effekt durchaus sinnvoll, denn durch die blitzschnelle Zusammensetzung von wenigen Informationen zu einer plausiblen Geschichte können wir beispielsweise in Gefahrensituationen schnell reagieren (z. B. „auf dem Waldboden bewegt sich etwas“ + „leichtes zischen“ = „gefährliche Schlange“). Die Schattenseite davon ist, dass andere relevante Informationen vernachlässigt werden und es deswegen zu voreiligen Schlussfolgerungen und Fehlurteilen kommt. Auch Selbstüberschätzung ist eine Folge des WSYIATI-Effekts, da der Grad der eigenen subjektiven Überzeugung überwiegend von der Geschichte abhängt, die wir über uns selbst erzählen können.
Betrachten wir hierfür noch mal kurz, was wir beim Eingangsbeispiel von Herrn Müller nicht getan haben. Wir haben uns beispielsweise nicht als Erstes gefragt, was wir genau wissen müssten, um uns eine fundierte Meinung über Herrn Müllers Führungskompetenz bilden zu können. Denn bereits mit dem ersten Adjektiv begann System 1 automatisch zu arbeiten: „intelligent ist gut, intelligent und stark ist sehr gut!“. Mit diesen zwei Adjektiven erstellte System 1 mühelos die erste Geschichte, die erst dann korrigiert wurde, als weitere relevante Informationen verfügbar wurden („korrupt“ und „skrupellos“).
Wie schwer es ist, sich dem WYSIATI-Effekt zu entziehen, zeigte eindrucksvoll eine Studie aus dem Jahr 1996, bei der es um fiktive Rechtsstreitigkeiten ging. Das eigentliche Ziel der Studie waren jedoch nicht die Rechtsstreitigkeiten an sich, sondern die Reaktionen der Versuchsteilnehmer, die dabei einseitige Informationen erhielten und dies auch wussten. Hierzu wurden die Versuchsteilnehmer, passend zu den jeweiligen Streitfällen, alle mit den gleichen Hintergrundinformationen ausgestattet. Zusätzlich hielten jeweils die Anwälte einer der beiden Streitparteien vor verschiedenen Gruppen kurze mündliche Vorträge, während bei anderen Versuchsteilnehmern beide Streitparteien ihre Vorträge hielten. Allerdings vermittelten die Anwälte bei ihren Vorträgen keine neuen Informationen, sondern präsentierten die bekannten Fakten, die die Versuchsteilnehmer aus der Hintergrundgeschichte bereits kannten. Obwohl die Anwälte somit nur die bereits bekannten Fakten präsentierten, zeigte sich, dass sich die Versuchsteilnehmer bei einseitigen Vorträgen ihrer Urteile sehr viel sicherer waren als Personen, die beide Streitparteien hörten. Dies ist insoweit bemerkenswert, als das es für die Versuchsteilnehmer kein Problem dargestellt hätte, sich die Gegenargumente der anderen Partei mental zu vergegenwärtigen. Die Forscher ziehen deswegen die Schlussfolgerung, dass für unsere Urteile und Überzeugungen maßgeblich die Konsistenz der Informationen maßgeblich ist (also eine möglichst plausible Geschichte von System 1), und nicht ihre logische Vollständigkeit.